Valencia, eine Stadt im Schatten der Tragödie. Einen Monat nach den verheerenden Fluten, die 230 Menschen das Leben kosteten, erhob sich die Bevölkerung – nicht in Stille, sondern in donnerndem Protest.
Fast hunderttausend Menschen strömten durch die Straßen, ihre Stimmen ein kollektiver Schrei des Zorns. Ihre Botschaft war unmissverständlich: Carlos Mazon, der Regionalpräsident, sollte zur Rechenschaft gezogen werden. „Mörder“, skandierten sie und hielten symbolisch ihre Handys in die Höhe – ein stummer Zeuge der fatalen Verzögerung.
Die Vorwürfe waren niederschmetternd. Die Warnmeldung der Behörden kam zwölf Stunden zu spät – eine Ewigkeit angesichts der hereinbrechenden Wassermassen. Um 20:11 Uhr, als die Warnung endlich die Telefone erreichte, waren die Straßen bereits Flüsse geworden.
222 Menschen allein in der Region Valencia verloren ihr Leben. Millionenschwere Schäden, zerstörte Existenzen, eine Landschaft verwüstet von den Wassermassen. Und mittendrin die bohrende Frage: Hätte dies verhindert werden können?
Die Demonstranten forderten mehr als nur Aufklärung. Sie wollten Verantwortlichkeit, Transparenz, das Eingeständnis des Systemversagens. Nicht nur Mazon, auch Ministerpräsident Pedro Sanchez gerieten unter Beschuss.
Der Aufmarsch war mehr als eine Demonstration. Er war ein kollektives Trauma, das Aufarbeitung forderte. Ein Moment, in dem Trauer in Wut, Verzweiflung in Entschlossenheit überging.
Valencia stand still – und schrie gleichzeitig.




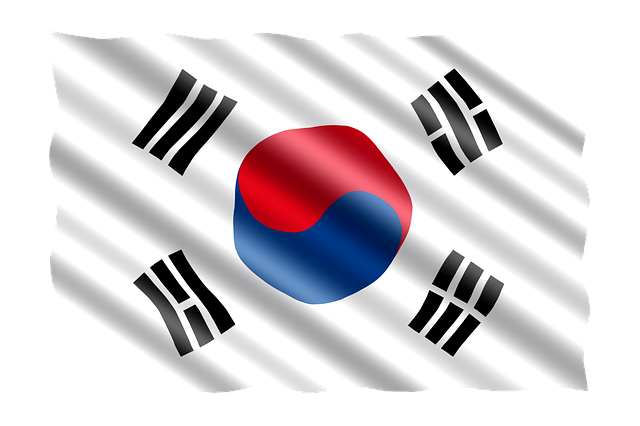





Kommentar hinterlassen