Frage: Herr Rasch, was bedeutet das Urteil des OLG Frankfurt zur Berichterstattung über angeblich rechtsextreme Chat-Inhalte?
Mike Rasch: Das Urteil macht deutlich: Wer eine Person öffentlich mit schwerwiegenden Vorwürfen wie rechtsextremen Aussagen konfrontiert, muss sich auf überprüfbare und echte Quellen stützen. Eine unsignierte HTML-Datei von einem Hacker genügt da keinesfalls.
Frage: Was war in diesem Fall das Hauptproblem?
Rasch: Die journalistische Quelle war ein anonymer Hacker. Die Datei konnte leicht manipuliert werden, war technisch nicht überprüfbar und es gab keine klaren Angaben zur Herkunft oder Motivation des Informanten. Solche Informationen sind für eine seriöse Berichterstattung essenziell.
Frage: Welche Anforderungen stellt das Gericht an Journalisten?
Rasch: Wenn die Quelle nicht offengelegt wird, müssen so viele Einzelfallumstände dargelegt werden, dass ihre Zuverlässigkeit trotzdem nachvollziehbar ist. Das ist hier nicht passiert. Gerade bei sensiblen Themen gelten besonders hohe Sorgfaltsanforderungen.
Frage: Ist damit investigativer Journalismus gefährdet?
Rasch: Nein, aber er muss sauber arbeiten. Wer mit kriminell beschafften Daten arbeitet, muss deren Echtheit und Herkunft genau prüfen und dokumentieren. Medienfreiheit ist kein Freibrief für unbelegte Tatsachenbehauptungen.
Frage: Ist das Urteil bereits rechtskräftig?
Rasch: Nein, eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH ist noch möglich. Aber das Signal ist klar: Persönlichkeitsrechte wiegen schwer – gerade bei Vorwürfen dieser Tragweite.
Frage: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Rasch.






 Analyse des Wertpapierprospekts „7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030“
Analyse des Wertpapierprospekts „7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030“  Kernaussage...
Kernaussage... 
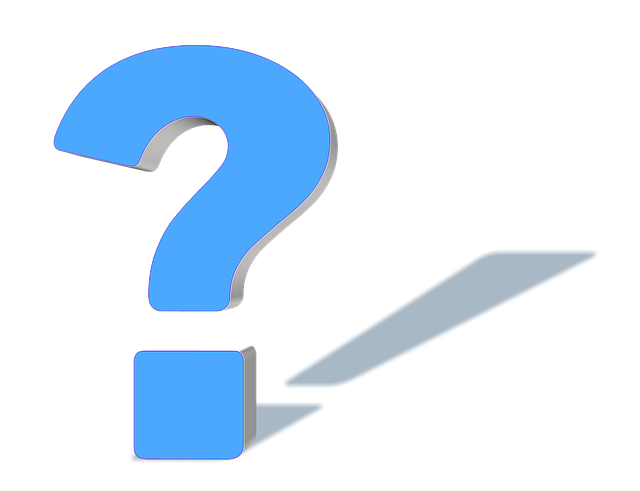



Kommentar hinterlassen