In aller Stille – und ganz ohne große Ankündigung – hat die US-Regierung einen bemerkenswerten Rückzieher in ihrem jüngsten Zollkrieg gegen China gemacht: Smartphones, darunter auch Apples iPhones, sind von den neuen 125 %-Importzöllen auf chinesische Waren ausgenommen worden.
Diese Entscheidung, die sich lediglich in einer unauffälligen Zollmitteilung („8517.13.00.00“) findet, ist nichts weniger als eine strategische Kehrtwende – vor allem, wenn man bedenkt, dass US-Handelsminister Howard Lutnick noch vor wenigen Tagen forderte, Apple solle die iPhone-Produktion zurück in die USA holen.
 Ohne Ausnahme: Preisexplosion für iPhones
Ohne Ausnahme: Preisexplosion für iPhones
Ohne die Ausnahme wäre der Schock in den US-Läden rasch spürbar geworden: 80 % der in den USA verkauften iPhones werden in China gefertigt. Bei geschätzten Gewinnmargen von 40–60 % hätte ein iPhone mit Zöllen wohl schnell die 2.000-Dollar-Marke überschritten. Die Alternative wäre gewesen, den Preis global anzuheben – mit politischem Sprengstoff für Apple weltweit.
 Hinter den Kulissen: Tim Cook als Friedensstifter?
Hinter den Kulissen: Tim Cook als Friedensstifter?
In dieser Situation könnte Apple-Chef Tim Cook zur Schlüsselfigur im US-chinesischen Verhältnis werden. Cook hat einen direkten Draht zu Präsident Trump wie auch zu Präsident Xi Jinping – und ist durch seine Rolle in der globalen Lieferkette eine Art diplomatischer Mittler zwischen den Wirtschaftsmächten.
 Das Ende der Tarif-Logik?
Das Ende der Tarif-Logik?
Der Strategiewechsel der USA betrifft nicht nur Smartphones: Auch Halbleiter, Solarmodule und Speicherkarten sind nun von Zöllen ausgenommen. Laut Capital Economics sind mittlerweile ein Viertel aller chinesischen Exporte in die USA vom 125 %-Zoll befreit – ein beachtlicher Anteil, wenn man bedenkt, dass die Tarife ursprünglich als Strafmaßnahme konzipiert waren.
Doch nicht nur China profitiert:
-
64 % der Exporte aus Taiwan,
-
44 % aus Malaysia,
-
und fast 30 % aus Vietnam und Thailand
sind nun ebenfalls ausgenommen – allesamt Länder mit großen Handelsüberschüssen gegenüber den USA.
 Eine Politik im Widerspruch zu sich selbst
Eine Politik im Widerspruch zu sich selbst
Noch vor wenigen Tagen lautete die Devise: „Wer mehr in die USA verkauft als umgekehrt, wird stärker besteuert.“ Jetzt aber bekommen ausgerechnet diese Länder die größten Rabatte. Sogar Großbritannien – ein traditioneller Verbündeter – muss weiter mit 25 % Zoll auf Autoexporte rechnen, obwohl es ein Handelsdefizit mit den USA hat.
Der einst klare Kurs des „America First“-Tarifregimes wirkt inzwischen wie ein Flickenteppich. Beobachter sprechen spöttisch vom „Art of the Repeal“ – einer Anspielung auf Trumps berühmtes „Art of the Deal“.
 Verhandlungen mit den Märkten – nicht mit Ländern
Verhandlungen mit den Märkten – nicht mit Ländern
Der eigentliche Gegenspieler scheint inzwischen nicht mehr China oder Europa zu sein, sondern die Anleihemärkte. Angesichts steigender Zinsen und einer wackelnden Investorenstimmung muss die US-Regierung offenbar zurückrudern – und verhandelt nun mit sich selbst.
 Fazit:
Fazit:
Was als harte Handelsstrategie begann, endet in einem politischen Rückzieher mit offenem Ausgang. Die große Frage bleibt:
Wie viel wirtschaftliche Realität verträgt die politische Inszenierung eines Handelskriegs – bevor das Glas wirklich zerspringt?





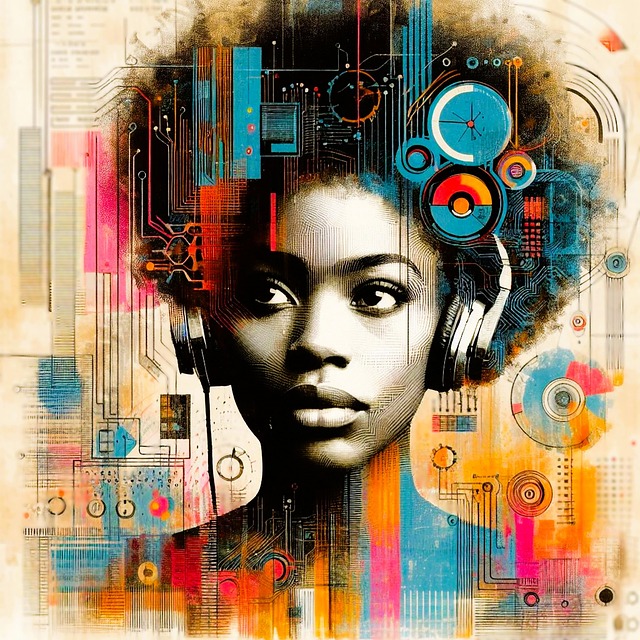





Kommentar hinterlassen