S-Präsident Donald Trump steht mit seinem umstrittenen Zollprogramm unter Druck: Die Finanzmärkte taumeln, Investoren sind nervös, selbst Unterstützer aus der Wirtschaft distanzieren sich – und dennoch hält Trump an seinem angekündigten „Befreiungstag“ am 2. April fest. An diesem Tag sollen neue, umfassende Zölle gegen fast alle Handelspartner der USA in Kraft treten.
Doch nun scheint Trump eine bewährte Taktik aus seiner Marketing-Trickkiste hervorzuholen: erst den maximalen Schock ankündigen – und dann eine abgeschwächte Version präsentieren, um die eigentlichen Maßnahmen vergleichsweise „harmlos“ erscheinen zu lassen.
„Vielleicht geben wir vielen Ländern eine Ausnahme“
Am Montag erklärte Trump, dass die Zölle wie geplant kommen sollen, schränkte aber zugleich ein, dass es bei einzelnen Branchen oder Ländern zu Verzögerungen oder Ausnahmen kommen könne. So sollen Zölle auf Autos „bald“ angekündigt werden, solche auf Medikamente und Halbleiter aber „irgendwann später“. Und sogar die eigentlich als zentrales Element vorgesehenen reziproken Zölle könnten „nicht ganz so hart ausfallen“, so Trump.
„Wir könnten sogar noch netter sein“, so Trump wörtlich in einer Kabinettssitzung.
Dieser Tonwechsel kommt nicht überraschend. Bereits nach seiner Wiederwahl hatte Trump vollmundig erklärt, Kanada und Mexiko mit 25 % Strafzöllen zu belegen – was dann nie in vollem Umfang umgesetzt wurde. Stattdessen wurden einzelne Maßnahmen verschoben oder stillschweigend abgeschwächt, etwa durch Ausnahmeregelungen innerhalb des USMCA-Freihandelsabkommens.
Tarife als „gerechte Vergeltung“
Experten wie Colin Grabow vom Cato Institute sehen in Trumps Strategie einen bewussten Versuch, die öffentliche Debatte zu lenken. Reziproke Zölle – also Zollmaßnahmen, die das Steuer-Niveau anderer Länder spiegeln – seien für die Bevölkerung leichter verständlich als komplexe sektorbezogene Handelsbarrieren.
„Wenn andere Länder uns Zölle aufbrummen, dann tun wir das auch. Das klingt nach Gerechtigkeit – und das verkauft sich besser“, so Grabow gegenüber CNN.
Länder wie Indien, die im internationalen Vergleich besonders hohe Zölle auf US-Waren erheben, bereiten bereits Senkungen vor, um amerikanische Gegenmaßnahmen zu vermeiden.
„Zehn verkaufen, sechs liefern“
Trumps wiederkehrendes Muster: Er kündigt harte Maßnahmen an – zum Beispiel flächendeckende Zölle von bis zu 60 % auf chinesische Waren – und liefert dann eine abgeschwächte Version (z. B. 20 % Zoll plus 25 % auf Stahl und Aluminium). Das Resultat bleibt schmerzhaft für die Wirtschaft, wirkt aber weniger dramatisch als zunächst befürchtet.
Doch auch „nur“ 20 % auf chinesische Produkte verursachen bereits jetzt erhebliche Probleme für Unternehmen – und drohen, auf die Verbraucherpreise durchzuschlagen. Tatsächlich ist das Vertrauen der Konsumenten bereits im März deutlich eingebrochen. Das Verbraucherklima in den USA fiel auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021.
Trump bleibt standhaft – trotz Gegenwind
Trotz der Kritik bleibt Trump seiner Linie treu. Als selbsternannter „Tariff Man“ sieht er sich auf einem wirtschaftlichen Kreuzzug gegen „ungerechten Handel“ und will die USA durch hohe Importzölle stärken – auch wenn die Märkte, Unternehmen und selbst Teile seiner Wählerschaft protestieren.
„Wir wurden von allen Ländern ausgenutzt“, sagte Trump diese Woche.
Die Botschaft ist klar: Selbst wenn die Zölle nicht so hart ausfallen wie zunächst angekündigt, wird Trump seine wirtschaftspolitische Linie nicht grundlegend ändern. Beobachter rechnen daher mit weiterem wirtschaftlichem Druck – und einem zunehmenden Balanceakt zwischen Protektionismus und politischer Schadensbegrenzung.
Fazit: Trump verkauft seinen Wählern die „Zehn“ – doch was letztlich kommt, ist oft nur eine „Sechs“. Für viele Unternehmen bleibt das trotzdem bitter. Die Märkte schauen nun gespannt auf den 2. April – und hoffen, dass der „Befreiungstag“ nicht zur Belastungsprobe für die Weltwirtschaft wird.





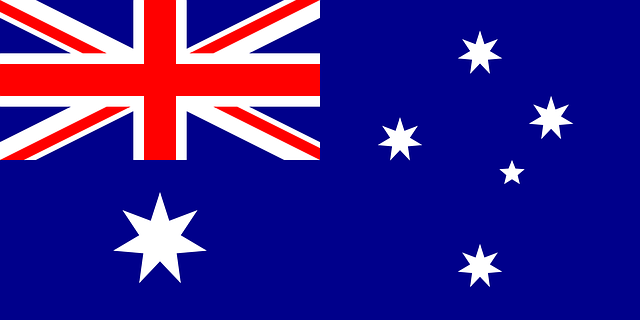





Kommentar hinterlassen