Interview mit dem Journalisten Thomas Bremer zur Entscheidung des OLG Frankfurt zur Verdachtsberichterstattung
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt: Eine Verdachtsberichterstattung im Fernsehen ist nur dann zulässig, wenn der Betroffene zuvor ausreichend zur Sache angehört wurde – auch dann, wenn er sich zunächst pauschal verweigert hat. Wir sprechen mit dem Medienrechtsexperten Thomas Bremer über die Konsequenzen dieser Entscheidung und was sie in der Praxis bedeutet.
Herr Bremer, das OLG Frankfurt hat die Anforderungen an Verdachtsberichterstattung erneut betont. Was ist der Kern dieser Entscheidung?
Thomas Bremer:
Der zentrale Punkt ist: Medien, insbesondere bei dokumentarischen Formaten, dürfen einen Verdacht gegen eine Person nicht einfach im Raum stehen lassen, ohne dieser Person vorher die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Und das bedeutet nicht irgendeine pauschale Anfrage, sondern eine inhaltlich konkrete Anhörung zu den geplanten Aussagen oder Zusammenhängen. Das Gericht sagt klar: Wer einen Verdacht in den Raum stellt – ob direkt oder durch suggestive Montage von Aussagen – der muss vorher sauber arbeiten.
In diesem Fall hatte der Betroffene ein Interview abgelehnt – genügt das nicht als Verweigerung der Mitwirkung?
Nein, genau das ist der Knackpunkt. Der Kläger hatte zwar erklärt, keine Stellungnahme abgeben zu wollen – aber ohne Kenntnis des konkreten Inhalts der geplanten Berichterstattung. Das Gericht betont, dass das nicht ausreicht, um auf eine inhaltliche Anhörung zu verzichten. Die Medien hätten nachliefern müssen – also den späteren Verdachtsmoment darlegen und explizit nachfragen: „Wie stehen Sie zu dieser konkreten These?“ Nur dann ist die Anhörung ernsthaft und fair.
Was bedeutet das für die journalistische Praxis, insbesondere bei Doku-Formaten oder investigativen Beiträgen?
Es bedeutet: Die journalistische Sorgfaltspflicht wird konkretisiert und verschärft. Medien dürfen sich nicht auf allgemeine Kontaktaufnahmen oder frühere Interviews berufen. Sie müssen sicherstellen, dass der Betroffene über den tatsächlichen Verdacht, der später geäußert oder nahegelegt wird, konkret informiert wurde – und dass ihm die Möglichkeit zur Reaktion eingeräumt wurde, bevor der Beitrag veröffentlicht wird.
Und wenn der Betroffene einfach gar nicht reagiert oder sich weiterhin verweigert?
Dann muss dokumentiert werden, dass eine inhaltlich klare und faire Anhörung versucht wurde. Reagiert die Person dann nicht oder verweigert erneut die Auskunft, kann das zur Entbehrlichkeit der Anhörung führen. Aber ohne diesen Versuch geht es nicht. Und wichtig ist: Die journalistische Anfrage muss nicht nur formal korrekt sein, sondern inhaltlich genau und transparent, damit der Betroffene überhaupt weiß, worauf er sich einlässt.
Das OLG sah auch ein Problem in der Art, wie im Film Informationen zusammengeschnitten wurden. Können auch neutrale Fakten zu einem unzulässigen Verdacht führen?
Ja – das ist ein spannender Punkt der Entscheidung. Das Gericht sagt: Auch wenn die verwendeten Aussagen für sich genommen wahr sind, kann ihre Kombination, dramaturgische Anordnung und die Art der Einbettung dazu führen, dass ein konkreter Verdacht implizit kommuniziert wird. Und genau dieser Verdacht muss dann im Vorfeld mitgeteilt werden. Das betrifft vor allem dokumentarische Formate, in denen man gerne mit Andeutungen und Spannungselementen arbeitet.
Was bedeutet die Entscheidung für Filmproduktionen, Redaktionen und Fernsehsender?
Sie müssen ihre redaktionellen Prozesse überprüfen. Es reicht nicht mehr, früh im Rechercheprozess ein Interview anzubieten oder sich auf frühere Aussagen des Betroffenen zu berufen. Vielmehr müssen sie sicherstellen, dass vor Fertigstellung oder Veröffentlichung eine zielgerichtete und transparente Anhörung zu den konkreten Aussagen oder Verdachtsmomenten erfolgt. Sonst drohen Unterlassungsklagen – mitunter mit empfindlichen Folgen für bereits produzierte und ausgestrahlte Beiträge.
Was können Betroffene tun, wenn sie sich in einer solchen Berichterstattung falsch oder unfair dargestellt fühlen?
Sie haben verschiedene Optionen: Im Eilverfahren – wie hier – können sie eine Unterlassung beantragen, wenn ein falscher oder unzulässig nahegelegter Verdacht geäußert wurde. Außerdem können sie auf Gegendarstellung, Widerruf und Schadensersatz klagen, wenn ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht oder der Ruf erfolgt ist. Wichtig ist: Auch wer keine eindeutige Behauptung, sondern nur einen suggestiven Zusammenhang erlebt, hat unter Umständen juristische Mittel.
Gibt es aus Ihrer Sicht eine Gefahr für die Pressefreiheit durch dieses Urteil?
Nein, das sehe ich nicht. Das Urteil verlangt keine Zensur, sondern Fairness. Es stärkt die Rechte der Betroffenen, aber innerhalb eines Rahmens, der die Sorgfaltspflicht der Presse konkretisiert. Wer sauber arbeitet, sorgfältig recherchiert und die Gegenseite wirklich hört, hat nichts zu befürchten. Wer aber bewusst mit Andeutungen arbeitet, ohne Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, muss mit juristischen Konsequenzen rechnen – und das ist gut so.
Herr Bremer, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Gerne, danke für das Gespräch.

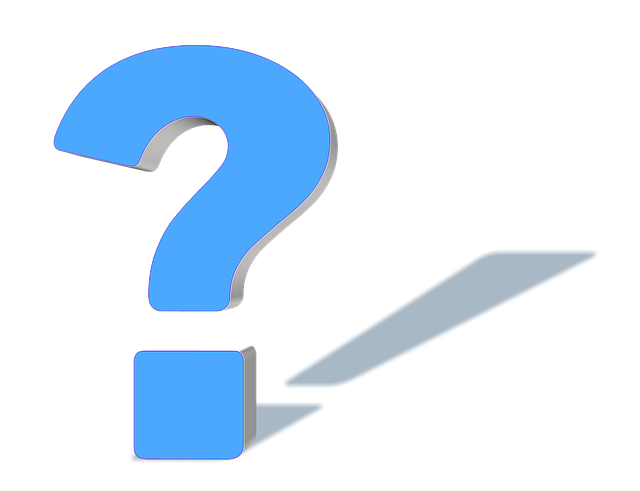



 Analyse des Wertpapierprospekts „7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030“
Analyse des Wertpapierprospekts „7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030“  Kernaussage...
Kernaussage... 





Kommentar hinterlassen